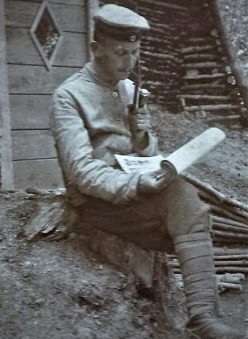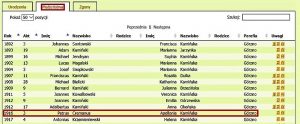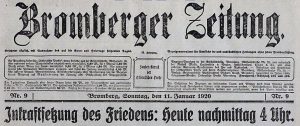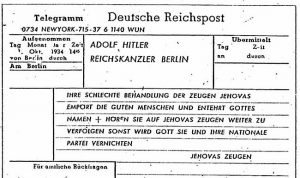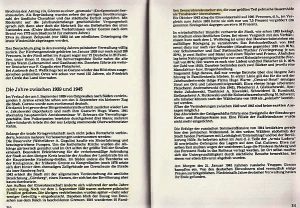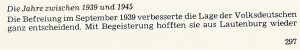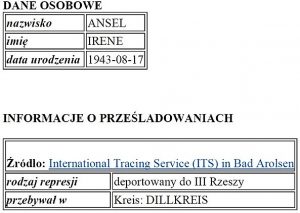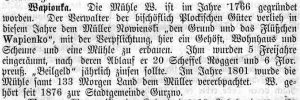Die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit (englisch Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ist eine von drei internationalen Listen, die die UNESCO erstellt. Auf der Liste des immateriellen Kulturerbes steht z.B. das Baguette aus Frankreich. Der traditionelle Herstellungsprozess des französischen Baguettes umfasst das Wiegen der Zutaten, das Mischen, Kneten, Fermentieren, Teilen, Entspannen, Formen, Gären, Markieren des Teigs mit flachen Einschnitten und das Backen. Immaterielles Kulturerbe sind in Polen z.B. die Kraukauer Weihnachtskrippen. In Polen gehören zum immateriellen Kulturerbe auch die Flößerei sowie die Baumimkerei bzw. die Waldbienenzucht .
 Von Zdroje nach Bartniczka gibt es nur eine Straße
Von Zdroje nach Bartniczka gibt es nur eine Straße
Meine Urgroßeltern kommen aus Zdroje, einem kleinen Straßendorf in der Landgemeinde Bartniczka, im Powiat Brodnicki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen. Bartniczka zählt knapp 5.000 Einwohner und besteht aus 13 Dörfern. Die Siedlung Zdroje ist so klein, das sie keinen Dorfstatus besitzt. Die Waldbienenzucht war in Zdroje schon früh bekannt. Hans Plehn schreibt in seiner 1900 erschienenen Abhandlung „Die Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreußen“ u.a.: „Bartniczka war … dem Namen nach eine Beutnerei.“
 Auszug Hans Plehn, Die Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreußen
Auszug Hans Plehn, Die Geschichte des Kreises Strasburg in Westpreußen
Im deutschen nannte man die damaligen Imker Zeidler oder Beutner, im polnischen wurden sie Bartnik genannt. Das Wappen der Gemeinde Bartniczka, besteht aus einem Baumstamm und drei Bienen. Einmal im Jahr findet in Bartniczka ein Honigfest statt.
 Wappen der Gemeinde Bartniczka, Quelle Wikipedia, gemeinfrei
Wappen der Gemeinde Bartniczka, Quelle Wikipedia, gemeinfrei
Der Beruf des Honigsammlers entwickelte sich im frühen Mittelalter. Man hieb alten Bäumen künstliche Höhlen (Beuten) in etwa sechs Meter Höhe ein und versah den Eingang mit einem Brett, in das ein Flugloch eingebracht war. Ob eine Beute von Bienen beflogen wurde oder nicht, hing ganz vom natürlichen Umfeld ab und wechselte jedes Jahr. Die Waldbienenzucht in lebenden Bäumen ist Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend aus Europa verschwunden.
 Imker beim Honigsammeln, Quelle Wikipedia, gemeinfrei
Imker beim Honigsammeln, Quelle Wikipedia, gemeinfrei
Das in den Wälder des preußischen Königs gefällte Holz war als Bau- und Brennholz für die Industrialiersung von wirtschaftlicher Bedeutung. Für den Abtransport des Holzes wurde bei Zdroje ein „Floss Canal“ gebaut, die Brynica (Branitza) wurde kanalisiert. Über die Drwęca (Drewenz) wurde das Holz mit Flößen an die Ostsee und in das Ruhrgebiet transportiert.
 Kartenausschnitt mit dem „Floss Canal“ bei Zdroje
Kartenausschnitt mit dem „Floss Canal“ bei Zdroje
Bei Bartniczka wurden die Hölzer der Königlichen Forstwälder Ruda und Brinsk für die öffentlichen Versteigerungen in einer Holzablagestelle gesammelt.
 Versteigerungs-Bekanntmachung in der Thorner Presse vom 25. Februar 1885
Versteigerungs-Bekanntmachung in der Thorner Presse vom 25. Februar 1885
„Holzversteigerungs-Bekanntmachung.
Am Freitag, den 13. März cr., sollen im Klebschen Gasthofe zu Bartniczka von Vormittags 11 Uhr ab ca. 1500 Stück Kiefern-Nutzhölzer der I.-IV. Tarklasse mit ca. 1800 Festmeter öffentlich meistbietend verkauft werden. Die Hölzer liegen an der Holzablage zu Bartniczka zum Verflößen bereit.
Kauflustige werden zu dem Termin mit dem Bemerken eingeladen, daß zu dem Tarwerth, welcher ca. 15000 M beträgt, die zu verausgabenden Fuhrlöhne sc. zugeschlagen werden. Die sonstigen Bedingungen werden in dem Termin selbst bekannt gemacht werden. Die Hölzer können auf der Ablage zu jeder Zeit besichtigt werden.
Ruda, den 25. Februar 1885
Der königliche Oberförster.“
 Flisak (Flößer) auf der Drwęca (Drewenz)
Flisak (Flößer) auf der Drwęca (Drewenz)
Die Brynica (Branitza) mündet bei Brodnica (Strasburg) in die Drwęca (Drewenz). Die Drwęca (Drewenz) ist ein rechter Nebenfluss der Wisla (Weichsel) und war bis zur Entwicklung von Eisenbahnen und Straßen eine wichtige und bequeme Handelsroute. Seit dem Mittelalter wurde Handel mit Toruń (Thorn) und Gdansk (Danzig) betrieben. Getreide, Teer, Pelze, Asche und Holz wurden auf dem Fluß transportiert. Von der Ostsee kamen gesalzene Lebensmittel und Salz.
 Die Drwęca (Drewenz) in Brodnica (Strasburg)
Die Drwęca (Drewenz) in Brodnica (Strasburg)
Seit Fertigstellung des Kanał Elbląski (Oberlandkanal) mit seinen fünf Rollbergen im Jahr 1860 gibt es auch eine Verbindung vom Drwęca-See bei Ostróda (Osterode) zum Hafen von Elbląg (Elbing) an der Ostsee. Mit dem Aufkommen der Eisenbahn wurde der Transport von Gütern auf dem Kanał Elbląski vollkommen bedeutungslos.

 Rollberge am Kanał Elbląski (Oberlandkanal)
Rollberge am Kanał Elbląski (Oberlandkanal)
Zdroje, das Dorf mit dem immateriellen Kulturerbe der Menschheit. wartet darauf entdeckt zu werden !!!