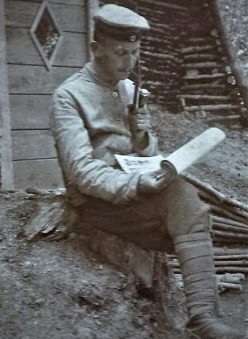Am 25. Oktober 1916 erschien Anton Jendrian auf dem Standesamt in Wompiersk und zeigte den Tod des Kätners Joseph Rosinski, Wehrmann im 1. Kompanie Landsturm-Ersatz–Bataillon XVII.20 (XVII. Armee-Korps in Danzig) an. Laut Sterbeurkunde war Johann Rosinski 43 Jahre alt und verheiratet mit Anna Karbowska. Er starb, nach Angabe auf der Sterbeurkunde, in der Wohnung des Anzeigenden am 24. Oktober 1916 vormittags um 11.30 Uhr.

Den Tod von Anna Rosinska, geborene Karbowska, 38 Jahre alt, zeigte Anton Jendrian ebenfalls an. Anna Rosinska starb nach Angabe auf der Sterbeurkunde in der Wohnung des Anzeigenden am 24. Oktober 1916 vormittags um 11.30 Uhr.
Am 24. Oktober 1916 um 11.30 Uhr verstarb in der Wohnung des Anton Jendrian auch Waclaw Rosinski, zwölf Jahre alt und Sohn von Joseph und Anna Rosinski.
Anton Jendrian zeigte ebenfalls den Tod von Joseph Simetkowski, 19 Jahre alt und ledig, an. Die Eltern von Joseph waren der verstorbene Kätner Johann sowie Angelika (geb. Rosinska) Simetkowski. Auch Joseph Simetkowski verstarb am 24. Oktober 1916 um 11.30 Uhr in der Wohnung des Anton Jendrian.
Angaben zu den Todesursachen werden auf den vier Sterbeurkunden nicht gemacht.
Was geschah am 24. Oktober 1916 in der Wohnung des Kätners Anton Jendrian?
Anton Jendrian war der ältere Bruder meines Urgroßvaters. Ein Kätner war ein abhängiger Kleinbauer oder Tagelöhner, der in einer Kate wohnt. Wompiersk (Wapiersk) ist ein kleines Dorf in Kreis Strasburg (Brodnica) in der ehemaligen Provinz Westpreußen. Anton Jendrian war mit Katharina Rosinska verheiratet. Katharina verstarb am 17. September 1916, 37 Tage vor dem Unglückstag. Katharina war die Schwester des am 24. Oktober 1916 verstorbenen Joseph Rosinski und von Angelika Simetkowska, geb. Rosinska, der Mutter des verstorbenen Joseph Simetkowski.
Am 24. April 1917 heiratete Anton Jendrian dann die Witwe Angelika Simetkowska, geb. Rosinska. Anton Jendrian hatte ein enges Verhältnis zur Familie Rosinski aus Wompiersk.
Ein kriegerisches Ereignis in Wompiersk war für den 24. Oktober 1916 auszuschließen, der Frontverlauf war 1916 weit östlicher. Eine Antwort zum Unglück von Wompiersk fand ich zufällig in „Die Presse“, der ostmärkischen Tageszeitung aus Thorn (Torun). Die Presse berichtete am 1. November 1916 über ein tragisches Unglück in Wompiersk.

„Wompiersk, Kreis Strasburg, 28. Oktober. (Fünf Personen ertrunken.) Ein bedauernswertes Unglück hat sich hier ereignet. Besitzer Roszinski aus Wompiersk, der aus dem Felde auf Urlaub gekommen war, hatte seinen Torf wegen des schlechten Weges auf dem kürzeren Wege nach Hause schaffen wollen. Er lud den Torf auf einen Kahn und fuhr mit diesem über einen 100 Meter breiten Teich. Bei der letzten Fuhre setzten sich noch dessen Ehefrau, der Sohn, Knecht und Magd auf den Kahn, welcher in der Mitte des Teiches so schnell sank, daß alle fünf Insassen, da keine Hilfe zur Stelle war, ertranken.“
 Nachricht über das Unglück in der Thorner Presse
Nachricht über das Unglück in der Thorner Presse
Am 31. Oktober 1916 schrieb die Berliner sozialdemokratische Parteizeitung „Vorwärts“: „Fünf Personen bei einer Kahnfahrt ertrunken. Aus Posen wird gemeldet: Als der aus dem Felde beurlaubte Besitzer Roszinski aus Wompiersk im Kreise Straßburg (Westpreußen) auf einem mit Torf beladenen Kahn über den 100 Meter breiten Teich nach Hause fahren wollte, sank der Kahn in der Mitte des Teiches und mit ihm fünf Personen: Roszinski, seine Ehefrau, sein Sohn, der Knecht und die Magd. Die Leichen sind noch nicht gefunden worden.“
 Nachricht über das Unglück im Vorwärts
Nachricht über das Unglück im Vorwärts
Die Meldung über das Unglück finden sich u.a. in den Lokalblättern „Der Gemeinnützige“ aus Iserlohn, der Lüner Zeitung, Das Volk aus Siegen, der Remscheider Zeitung, der Geldernsche Zeitung, der Dorstener Volkszeitung und Wochenblatt, dem Erft-Boten aus Bedburg. Am 3. November 1916 erschien die Nachricht in der Sächsische Dorfzeitung und Elbgaupresse, mit Loschwitzer Anzeiger, Tageszeitung für das östliche Dresden und seine Vororte sowie einen Tag später im General-Anzeiger für Halle und die Provinz Sachsen.
„Fünf Menschen ertrunken. Ein schweres Unglück hat sich in Strasburg (Westpreußen) ereignet. Der in Wompiersk wohnende Besitzer Roszinski wollte seinen Torf des schlechten Landweges wegen auf einem Kahn über einen etwa 200 Meter breiten Teich nach Hause schaffen. Bei der letzten Fuhre setzten sich noch seine Frau, sein Sohn, ein Knecht und eine Magd auf den Kahn. In der Mitte des Teiches schlug das Fahrzeug plötzlich um und alle fünf Personen ertranken.“
 Nachricht über das Unglück im General-Anzeiger für Halle und die Provinz Sachsen
Nachricht über das Unglück im General-Anzeiger für Halle und die Provinz Sachsen
Wie könnte ein mit Torf beladener Kahn ausgesehen haben?
 Torfkahn in den Niederlanden, Quelle Wikipedia, Baykedevries
Torfkahn in den Niederlanden, Quelle Wikipedia, Baykedevries
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turf_praam.jpg), „Turf praam“, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
 Der Jellen-See bei Wompiersk/Wapiersk
Der Jellen-See bei Wompiersk/Wapiersk
Der Unglückort von 1916 könnte sich möglicherweise am Jellen-See bei Wompiersk/Wapiersk befinden. Zumindest ist die Frage geklärt, was am 24. Oktober vormittags um 11.30 Uhr in Wompiersk, Kreis Strasburg, Westpreußen, geschah. Über die ertrunkene und unbekannte Magd des Besitzers Rosinski finden sich keine Hinweise.